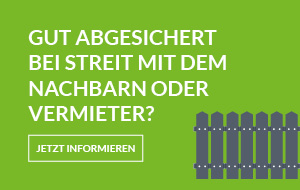© iStock.com/FangXiaNuo
© iStock.com/FangXiaNuo
18. Juni 2024, 10:02 Uhr
Darf ich eigentlich? Schrebergarten mieten oder kaufen: Die Regeln für Kleingärtner
Viele Städter träumen davon, einen Schrebergarten zu mieten, in dem sie am Wochenende pflanzen, ernten und entspannen können. Wer über eine eigene Parzelle nachdenkt, sollte sich aber bewusst sein, dass das mit einigen Regeln verbunden ist. Was du wissen musst, damit die Entspannung nicht durch Ärger mit dem Gartennachbarn oder dem Kleingartenverein getrübt wird, liest du hier.
Streit am Gartenzaun statt Idylle im Grünen? Wir finden eine Lösung >>
Schrebergarten pachten: So kommst du an eine eigene Scholle
Strenggenommen kannst du einen solchen Kleingarten oder Schrebergarten nicht mieten, sondern nur pachten. Das liegt an § 581 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). Dieser besagt, dass du aus einem Mietobjekt keinen wirtschaftlichen Ertrag ziehen darfst – aus einer Pachtsache hingegen schon. Du bekommst damit also das volle Nutzungsrecht für den Garten und die Erträge daraus, wie etwa Obst und Gemüse, stehen dir zu.
Was ist ein Schrebergarten?
Der Begriff Schrebergarten geht auf den Leipziger Arzt Dr. Moritz Schreber zurück, der im 19. Jahrhundert die Idee von städtischen Erholungsgärten zur „körperlichen Ertüchtigung“ der Stadtjugend förderte. Diese Areale bestanden aus einer Wiese zum Spielen und Turnen. Außerdem waren Beete und Gärten zur Beschäftigung angelegt. Daraus entwickelten sich im Laufe der Zeit die heute bekannten Schrebergärten. Diese sind in einzelne, umzäunte Parzellen aufgeteilt: Jede Parzelle verfügt üblicherweise über eine eigene kleine Gartenhütte und muss nach bestimmten Regeln und Vorschriften gepflegt werden.
Einfach einen Garten mieten und losgärtnern ist allerdings nur in den wenigsten Fällen möglich. Oft ist ein wenig Geduld gefragt. So gehst du vor:
- Geeigneten Garten finden: Zum Teil werden freie Kleingärten in Lokalzeitungen und im Internet inseriert. Daneben bleibt dir noch die Möglichkeit, direkt bei Kleingartenvereinen nachzufragen und eine Bewerbung für eine Schrebergarten-Parzelle einzureichen.
- Vorstand überzeugen: Vor allem in Großstädten, wo Schrebergärten sehr begehrt sind, musst du häufig erst den Vorstand davon überzeugen, dass du zum Verein passt. Wenn du aufgenommen wirst, kommst du auf eine Anwärterliste für einen Garten.
- Mitglied werden und Garten pachten: Spätestens, wenn ein passender Garten frei wird und du den Pachtvertrag unterschreibst, musst du Mitglied im Kleingartenverein werden. Abhängig von der Vereinssatzung kann eine Vereinsmitgliedschaft aber auch schon vorher erforderlich sein.
- Ablöse an den Vorbesitzer zahlen: Der Pachtvertrag gilt nur für das Grundstück selbst. Darauf befindliche Pflanzen und ein möglicherweise vorhandenes Gartenhaus musst du in der Regel vom Vorgänger ablösen. Neben den regelmäßigen Zahlungen für Pacht und Vereinsmitgliedschaft wird also noch eine einmalige Ablösesumme fällig.
Übrigens: Selbst kaufen kannst du einen Schrebergarten oder Kleingarten nicht – er gehört dem Kleingartenverein.

Diese gesetzlichen Grundlagen gelten im Kleingarten
In Deutschland sind Schrebergärten durch das Bundeskleingartengesetz (BKleingG) geregelt. Dieses Gesetz definiert, was als Kleingarten gilt, und stellt sicher, dass diese Gärten vor allem der kleingärtnerischen Nutzung und der Erholung dienen.
Das BKleingG gibt dazu in § 3 vor: „Die Belange des Umweltschutzes, des Naturschutzes und der Landschaftspflege sollen bei der Nutzung und Bewirtschaftung des Kleingartens berücksichtigt werden.“
Zudem müssen Kleingärtner weitere rechtliche Regelungen berücksichtigen. Grundsätzlich gilt das allgemeine Pachtrecht nach § 581 bis § 584 BGB, sofern sich keine gesonderten Regeln aus dem Bundeskleingartengesetz ergeben.
Solaranlage im Schrebergarten: Ja oder Nein?
Wichtig für Stromsparer: Ob du eine Solaranlage im Schrebergarten nutzen darfst, ist nicht im BKleingG geregelt. An sich ist die Nutzung von Mini-PV-Anlagen für Arbeitsstrom nach Aussage der Bundesregierung auch in Kleingärten bereits zulässig, solange der Strom kleingärtnerisch genutzt wird (Drucksache 20/9645 Gesetzentwurf des Bundesrates). Allerdings läuft aktuell (Stand:13.06.2024) ein Zivilprozess gegen einen Kleingartenverein in der Nähe von Berlin: Dieser hatte den Pachtvertrag eines Ehepaars gekündigt, das im Kleingarten eine Solaranlage auf dem Dach seines Gewächshauses installiert hatte (AZ 350 C 199/24). Wie das Verfahren ausgeht, ist noch ungewiss. Es könnte zum Präzedenzfall werden.
Schrebergarten kündigen - so geht's
Auch die Kündigung eines Schrebergartens durch den Verpächter regelt das BKleingG: Der Pachtvertrag darf nämlich nur zum 30. November eines Jahres ordentlich schriftlich gekündigt werden. Dieses Datum wird oft als Ende des Gartenjahres betrachtet.
Dabei gilt gemäß § 9 BKleingG Abs. 2 für Schrebergärten eine Kündigungsfrist von etwa vier Monaten, wenn der Garten beispielsweise nicht vertragsgemäß genutzt wird. Konkret: Die Kündigung muss dem Pächter spätestens am 3. Werktag im August vorliegen. Bei organisatorischen Kündigungsgründen wie Eigenbedarf oder Neuordnung der Kleingartenanlage gilt eine rund zehnmonatige Kündigungsfrist. Spätester Eingangstermin ist hier der dritte Werktag im Februar.
Wann Pächter den Pachtvertrag für ihren Schrebergarten kündigen können, regelt hingegen für gewöhnlich die Verordnung des Kleingartenvereins. Meist ist der Stichtag hier ebenfalls der 30. November.

Allgemeine Regeln und Pflichten für Kleingärtner
Kleingärtner müssen sich an die Vorschriften und Satzungen des jeweiligen Kleingartenvereins halten, bei dem sie ihre Parzelle gepachtet haben. Hinsichtlich der Größe und der Bebauung ergeben sich verbindliche Regeln vonseiten des Gesetzgebers.
Die Vorschriften des Kleingartengesetzes fließen in die Verordnungen und Satzungen der Kleingartenvereine ein.
- Die Gartenlaube,dein eigenes kleines Haus im Schrebergarten, darf in ihrer Gesamtfläche nicht größer als 24 Quadratmeter sein.
- Diese Gartenlaube darf nicht dauerhaft bewohnt werden. Du kannst also nicht in deinem Schrebergarten wohnen. Einer gelegentlichen Übernachtung nach geselligem Beisammensein steht hingegen nichts im Wege.
- Die Gesamtfläche eines Schrebergartens darf nicht größer als 400 Quadratmeter sein.
- Mindestens ein Drittel der Fläche sollte „zur Gewinnung von Gartenbauerzeugnissen“ genutzt werden – also in erster Linie für den Obst- und Gemüseanbau.
- Die Erträge aus dem Kleingarten sind für den Eigenbedarf. Du darfst geerntetes Obst und Gemüse nicht mit Gewinninteresse verkaufen.
Die Satzung von Kleingartenvereinen enthält mehr oder weniger genaue Vorgaben, was wie und wo gepflanzt, gesät und angebaut werden darf. Für Ziergehölze und andere Pflanzen gelten meist bestimmte Regeln in Sachen Höhe und Abstand.
Außerdem ist in der Vereinsordnung üblicherweise auch festgelegt, wann laute Gartenarbeiten wie Rasenmähen oder Heckenschnitt erlaubt sind und welche Ruhezeiten gelten.
Den meisten Vereinen ist eine gewisse Einheitlichkeit mit Blick auf die Erscheinung der Kleingartenkolonie wichtig. Abgeschottetes Dasein hinter meterhohen Hecken etwa ist nicht im Sinne des Vereinslebens und würde sicherlich nicht genehmigt werden. Zudem können Verpflichtungen zu Arbeitseinsätzen, beispielsweise zur Instandhaltung gemeinschaftlich genutzter Einrichtungen, enthalten sein.
Die Einhaltung dieser Schrebergartenregeln wird regelmäßig von den Vereinsvorständen kontrolliert. Verstöße können zu Abmahnungen oder im Extremfall zur Kündigung des Pachtvertrages führen.
Das darfst du in deinem Schrebergarten
Du hast viele Möglichkeiten, deinen grünen Rückzugsort individuell zu gestalten und dich mitten im Schrebergarten oder auf der Terrasse deiner Laube zu entspannen. Einige Dinge musst du dabei allerdings beachten.
- Tiere dürfen in Kleingartenanlagen grundsätzlich nicht gehalten werden. Eine Ausnahme gibt es nach § 20a BKleingG nur für Kleingärtner, die bereits vor der deutschen Wiedervereinigung im Kleingarten Tiere wie beispielsweise Hühner oder Bienen gehalten haben und das bis heute ununterbrochen tun.
- Ein Kleingarten muss abwasserfrei bleiben. Willst du also eine Toilette in deinem Schrebergarten nutzen, muss es sich dabei um eine Trocken- oder Komposttoilette handeln.
- Ein Pool ist im Schrebergarten üblicherweise nicht gestattet, da er gegen das Prinzip der kleingärtnerischen Nutzung verstößt. Anders sieht es jedoch mit kleinen Planschbecken für Kinder aus.
Bitte lesen Sie zu dem Inhalt auch unsere Rechtshinweise.