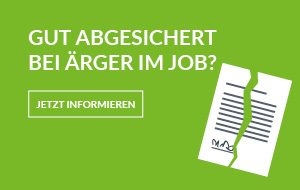© iStock.com/shapecharge
© iStock.com/shapecharge
16. März 2023, 11:08 Uhr
Darf ich eigentlich? Sachgrundlose Befristung: Das gilt im Arbeitsvertrag
Bist du befristet angestellt, endet dein Vertrag in der Regel, wenn das vereinbarte Enddatum erreicht oder der Zweck der Befristung erfüllt ist. Liegt eine sogenannte sachgrundlose Befristung vor, gibt es allerdings mehrere Dinge zu beachten – denn diese ist nur unter bestimmten Bedingungen erlaubt. Hier erfährst du, wie lange du ohne Sachgrund beschäftigt werden darfst und welche Regelungen noch gelten.
Ärger mit dem Chef? Wir helfen dir! >>
Befristete Arbeitsverträge: Diese Grundregeln stellt das Gesetz auf
Wann die Befristung eines Arbeitsvertrags zulässig ist, regelt § 14 Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG).
Ein befristeter Arbeitsvertrag darf in der Regel geschlossen werden, wenn ein sachlicher Grund dafür vorliegt. Ein solcher Grund kann zum Beispiel eine Elternzeit-, Urlaubs- oder Krankheitsvertretung sein. Unter bestimmten Bedingungen sind aber auch befristete Arbeitsverträge ohne Sachgrund rechtens. Damit die Befristung wirksam wird, muss in beiden Fällen der Arbeitsvertrag schriftlich geschlossen werden.
Mehr zu diesem Thema erfährst du in unserem Ratgeber „Befristeter Arbeitsvertrag: Was du wissen musst“.
Sachgrundlose Befristung: Was ist das?
Ein befristeter Arbeitsvertrag mit Sachgrund ist stets mit einem konkret bezeichneten Anlass oder Ziel verbunden. Bei einer sachgrundlosen Befristung ist das der Definition nach nicht der Fall. Stattdessen braucht es in diesem Fall keine ausgesprochene vertragliche Begründung für die Befristung. Wichtig: Für die sachgrundlose Befristung gilt allerdings eine zeitliche Befristung, die nicht überschritten werden darf.
Gibt es keinen Sachgrund, dann ist die Befristung gemäß § 14 Absatz 2 TzBfG grundsätzlich nur unter folgenden Umständen erlaubt:
- Die Dauer darf insgesamt zwei Jahre nicht überschreiten.
- Du darfst bis zu drei direkt aufeinanderfolgende ohne Sachgrund befristete Arbeitsverträge über kürzere Zeiträume abschließen – sofern diese insgesamt nicht länger als zwei Jahre andauern.
- Willst du nach Ablauf der zwei Jahre weiter bei deinem Arbeitgeber beschäftigt werden, dann geht dies nur unbefristet. Es sei denn, es ist inzwischen ein Sachgrund eingetreten, der eine erneute Befristung rechtfertigt.
Für eine sachgrundlose Befristung ist darüber hinaus keine weitere Verlängerung vorgesehen. Gemäß § 14 Absatz 2a und Absatz 3 TzBfG gelten allerdings folgende Ausnahmen:
- Du darfst in noch jungen Unternehmen während der ersten vier Jahre ihres Bestehens ohne Sachgrund befristet beschäftigt werden.
- Bist du mindestens 52 Jahre alt und warst vor deiner Einstellung mindestens vier Monate lang arbeitslos, hast Transferkurzarbeitergeld erhalten oder hast an einer öffentlich geförderten Beschäftigungsmaßnahme teilgenommen, darfst du maximal fünf Jahre lang ohne Sachgrund befristet beschäftigt werden.
Wichtig: In Tarifverträgen können gegebenenfalls weitere abweichende Regelungen getroffen werden.

Vorbeschäftigungsverbot ist zu beachten
Eine weitere Einschränkung für eine sachgrundlose Befristung stellt das sogenannte Vorbeschäftigungsverbot dar. Demgemäß darfst du keine sachgrundlose Befristung mit einem Arbeitgeber absprechen, wenn du bereits zuvor für ihn gearbeitet hast. Damit besteht hier ein Vorbeschäftigungs- beziehungsweise ein Anschlussverbot.
Aber gilt das auch, wenn die frühere Tätigkeit schon Jahre oder gar Jahrzehnte zurückliegt? Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) entschied dazu 2018, dass eine solche Einschränkung grundgesetzwidrig sei und dass es Ausnahmen geben könne, wenn die Vorbeschäftigung zum Beispiel von ganz anderer Art gewesen sei oder „sehr lange“ zurückliege (AZ 1 BvL 7/14 und 1 BvR 1375/14).
Der Frage, wie lang in diesem Zusammenhang „sehr lange“ ist, hat sich das Bundesarbeitsgericht (BAG) 2019 mit zwei Urteilen angenähert. So erklärte das BAG den sachgrundlos befristeten Arbeitsvertrag eines Arbeitnehmers für unzulässig, da dieser bereits acht Jahre zuvor für denselben Arbeitgeber tätig gewesen sei (AZ 7 AZR 733/16).
Mit einem Urteil vom August 2019 ließ das BAG hingegen 22 Jahre Pause als hinreichend lang gelten, um eine frühere Arbeitnehmerin wieder sachgrundlos befristet einstellen zu dürfen (AZ 7 AZR 452/17).
Gut zu wissen: Ist eine Sachgrundbefristung nach sachgrundloser Befristung erlaubt? Ja, das ist möglich. Der umgekehrte Fall ist allerdings nicht gestattet.
Kettenbefristung ohne Sachgrund: Zulässig?
Das Vorbeschäftigungsverbot existiert in erster Linie, um dich vor einer Kettenbefristung zu schützen, die für dich nachteilig und mit Unsicherheiten verbunden ist. Zu einer Kettenbefristung käme es, wenn ein befristeter Arbeitsvertrag immer wieder verlängert würde, ohne dass es zu einer unbefristeten Anstellung kommt.
Ohne Sachgrund ist das gemäß TzBfG in der Regel nicht länger als zwei Jahre zulässig – es sei denn, es gelten die oben genannten besonderen Bedingungen wie etwa eine Unternehmensgründung.
Die sachgrundlose Befristung ist nicht unumstritten. Es gibt Gesetzesentwürfe, wonach die sachgrundlose Befristung von Verträgen statt 24 Monate nur noch für eine Dauer von 18 Monaten erlaubt sein soll. Auch soll nur noch eine Verlängerung erlaubt sein und nicht mehr drei.
Ebenfalls beabsichtigt ist ein quantitatives Limit: Unternehmen mit mehr als 75 Beschäftigten dürfen höchstens 2,5 Prozent ihrer Belegschaft mit einer sachgrundlosen Befristung anstellen. Ob und wann die Neuregelung kommt, ist derzeit allerdings unklar (Stand: März 2023).
Arbeitnehmer können sich mit Entfristungsklage wehren
Durch eine Entfristungsklage kannst du im Zweifel überprüfen lassen, ob die Befristung deines Arbeitsvertrags rechtmäßig ist. Kommt das zuständige Gericht zu dem Schluss, dass dies nicht der Fall ist, muss du unbefristet beschäftigt werden – oder du einigst dich mit deinem Arbeitgeber auf eine andere Lösung, etwa eine Abfindung.
Hast du länger ohne Sachgrund befristet gearbeitet, als eigentlich vorgesehen war, hast du unter Umständen ebenfalls die Möglichkeit, eine Entfristung zu erwirken. So gab das Landesarbeitsgericht Düsseldorf 2019 der Klage eines befristet beschäftigten Arbeitnehmers auf unbefristete Beschäftigung statt (AZ 3 Sa 1126/18). Der Mann machte erfolgreich geltend, dass die Befristungshöchstdauer von zwei Jahren um einen Tag überschritten worden war.
- Die sachgrundlos befristete Beschäftigung ist grundsätzlich bis zu einer Dauer von maximal zwei Jahren erlaubt. Es gibt jedoch einige Ausnahmen.
- Dabei ist das Vorbeschäftigungsverbot zu beachten sowie für Arbeitnehmer entscheidend, dass eine wiederholte Befristung nicht zu einer unzulässigen Kettenbefristung führt.
- Hast du mit einer Entfristungsklage Erfolg vor Gericht, kann eine unbefristete Beschäftigung die Folge sein.
Bitte lesen Sie zu dem Inhalt auch unsere Rechtshinweise.